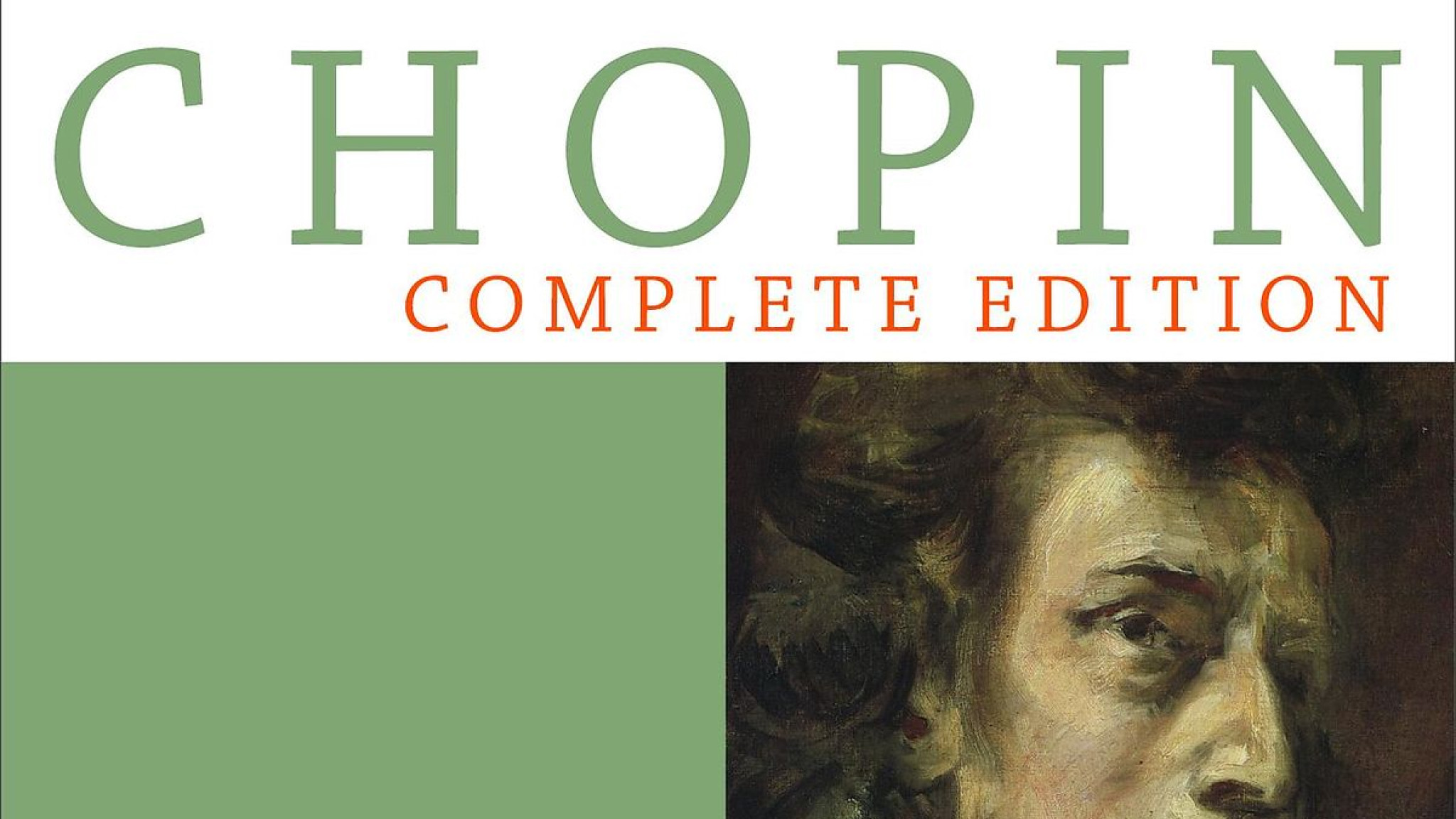Ein Griff in die Schatzkiste

Manchmal kann man froh sein, dass sich die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit Nachdruck um bestimmte Aufnahmen gekümmert haben. Denn hätten die Produzenten etwa Ende der Achtziger gezögert, als Claudio Arrau sich noch einmal ins Studio begeben wollte, wären der Musikwelt wunderbare Momente interpretatorischer Intensität entgangen. So aber hat die Decca die Möglichkeit, die “Final Sessions” der 85- bis 88jährigen Eminenz der Klavierkunst nun in einer 7CD-Box gesammelt herauszugeben, ebenso wie die Brahms-Deutungen von Ricchardo Chailly und den jugendlichen Schubert von Frans Brüggen.
In den Achtzigern waren sich viele Klassikfreunde sicher, dass die Karriere Claudio Arraus beendet wäre. Persönliche Tragödien wie der Tod seiner Frau und seines Sohnes hatten ihn schwer mitgenommen, er kämpfte mit Depressionen, brach sich schließlich bei einem Unfall ein Handgelenk. Doch der in Chile geborene Pianist, einer der letzten überhaupt, der durch seine Ausbildung und Spielweise noch eine persönliche Beziehung zur Musik der Romantik und der Jahrhundertwende hatte, ließ sich nicht unterkriegen. Seine Liebe zu den göttlichen Klängen eines Bachs, Beethovens, Schuberts oder Debussys trieb ihn ans Klavier zurück und die zunehmende Perfektion der Aufnahmetechnik ermöglichte es, die markante Detailarbeit etwa in Anschlag und Nuancierung auch adäquat festzuhalten. Um 1988 begann Arrau, sich noch einmal für ein großes Aufnahmeprojekt ins Studio zu begehen. Auf der Liste der bevorzugten Interpretationen hatte er neben seinen oben genannten Hausheroen auch Ravel, Skrjabin und Stockhausen. Außerdem wollte er ein paar Lücken seines Mozart-Repertoires noch schließen. Da er jedoch 1991 zwar hochbetagt, aber trotzdem überraschend starb, kam es jedoch nur zu einem Teil der Studiositzungen. Dazu gehörten mehrere Beethoven-Sonaten und Bach-Partiten, Schuberts “Impromptus D935”, “Moments Musicaux D780” , “Klavierstücke D946” und die G-Dur Sonate, außerdem ein paar Ausschnitte aus Debussys Klaviermusik. Diese “Final Sessions” wurden zu einer Offenbarung der Differenziertheit und klanglichen Noblesse. Sie füllen sieben CDs und sind doch weit mehr als diese Stücke auf den Tonträgern. Sie sind ein Verbindungsstück zu einer Welt, die den musikalischen und emotionalen Alltag gelassen hinter sich lässt.
Beethoven war nicht nur für Claudio Arrau eine der prägenden Gestalten des künstlerischen Bewusstseins. Auch Berufskollegen wie Johannes Brahms ließen sich von der kreativen Autorität und musikalischen Dominanz beeinflussen. Nicht zuletzt deshalb hat er lange gewartet, bis er sich an die Komposition einer eigenen Sinfonie wagte – so übermächtig war Beethovens Aura. Erst 1876 brachte der inzwischen 43-jährige Brahms sein erstes Orchesterwerk dieser Art zum Abschluss. Dann allerdings folgte, nach einsetzendem Erfolg bereits im Sommer 1877 eine zweite Sinfonie. Brahms erschien wie ausgewechselt, nach dem qualvollen Ringen um das Debüt im düsteren c-moll wirkte er nun in D-Dur locker und entspannt, stellenweise heiter. Daraufhin folgte wiederum eine Pause bis 1883, bis er sich mit der melancholisch wirkenden Dritten in F-Dur auf dem sinfonischen Parkett zurück meldete. Einmal noch wagte er sich zwei Jahre später an diese Form und die “4.Sinfonie” in c-moll gilt tatsächlich als Conclusio von Brahms' Bemühungen, die strenge Orchestersprache der Klassik in die farbenreiche Welt der Romantik zu überführen. Insofern sind gerade diese vier Werke eine reizvolle Spielwiese für Dirigenten, die ihre umfassende Kompetenz im Umgang mit dramatischer Klanggestaltung demonstrieren wollen. Riccardo Chailly etwa hat sich zwischen 1987 und 1991 mit dem Royal Concertgebouw Orchestra immer wieder an Brahms angenähert und ihm mit Gespür für interpretatorische Klarheit in der Opulenz ein Denkmal gesetzt. Auf drei CDs zusammengefasst kann diese ausgezeichnete Auseinandersetzung für sich genossen, aber auch als Vorgriff auf die Beschäftigung mit Mahler gesehen werden, die Chailly in den folgenden Jahren herausforderte.
Im Unterschied zum zaudernden Brahms war Franz Schubert gerade mal 16 Jahre alt, als er sich an das Verfassen seiner ersten Sinfonie wagte. Obwohl er noch als Schüler am kaiserlich-königlichen Stadtkonvikt in Wien lernte, hatte er bereits genug Selbstbewusstsein, sein Werk nicht nur zu entwerfen, sondern gleich in die Notenzeilen der Partitur zu schreiben. Einer seiner Mitschüler, Albert Stadler, berichtete später nicht ohne Bewunderung: “Ganz ruhig und wenig beirrt durch das im Konvikte unvermeidliche Geplauder und Gepolter seiner Kameraden um ihn her, sass er am Schreibtischchen … und schrieb leicht und flüssig, ohne viele Korrekturen fort, als ob es gerade so und nicht anders sein müsste”. Dreizehn Sinfonien begann er insgesamt während der kommenden Jahre, sieben davon wurden auch vollendet, aber keine konnte der Komponist zu Lebzeiten über private Aufführungen hinaus öffentlich in einem Konzert hören. Wohlmöglich hätte ihn eine solche Erfahrung noch weiter in seiner auffallend ausdifferenzierten Klangsprache voran gebracht, in jedem Fall sind aber die erhaltenen sieben Orchesterwerke bereits eine herausragende Stellungnahme eines jungen Genies zu einer Form, die durch Vorgänger wie Beethoven oder Haydn tiefgreifend geprägt worden war. Und sie wurden in den Jahrzehnten der Interpretationsgeschichte häufig als frühromantische Ausdrücke einer genialischen Seele gedeutet, was nicht zuletzt zu einigen Umwertungen führte. Anfang der 1990er Jahre machte sich daher der holländische Dirigent und Flötist Frans Brüggen daran, die Sinfonien zusammen mit dem “Orchestra Of The 18th Century” unter kritischen Gesichtspunkten auf historischen Instrumenten zu spielen. Heraus kam eine Schubert-Aufnahme, die durch ihrer Frische, Farbigkeit und Vitalität besticht und nun auf 4 CDs als Sammlung in einer Box vollständig vorliegt.